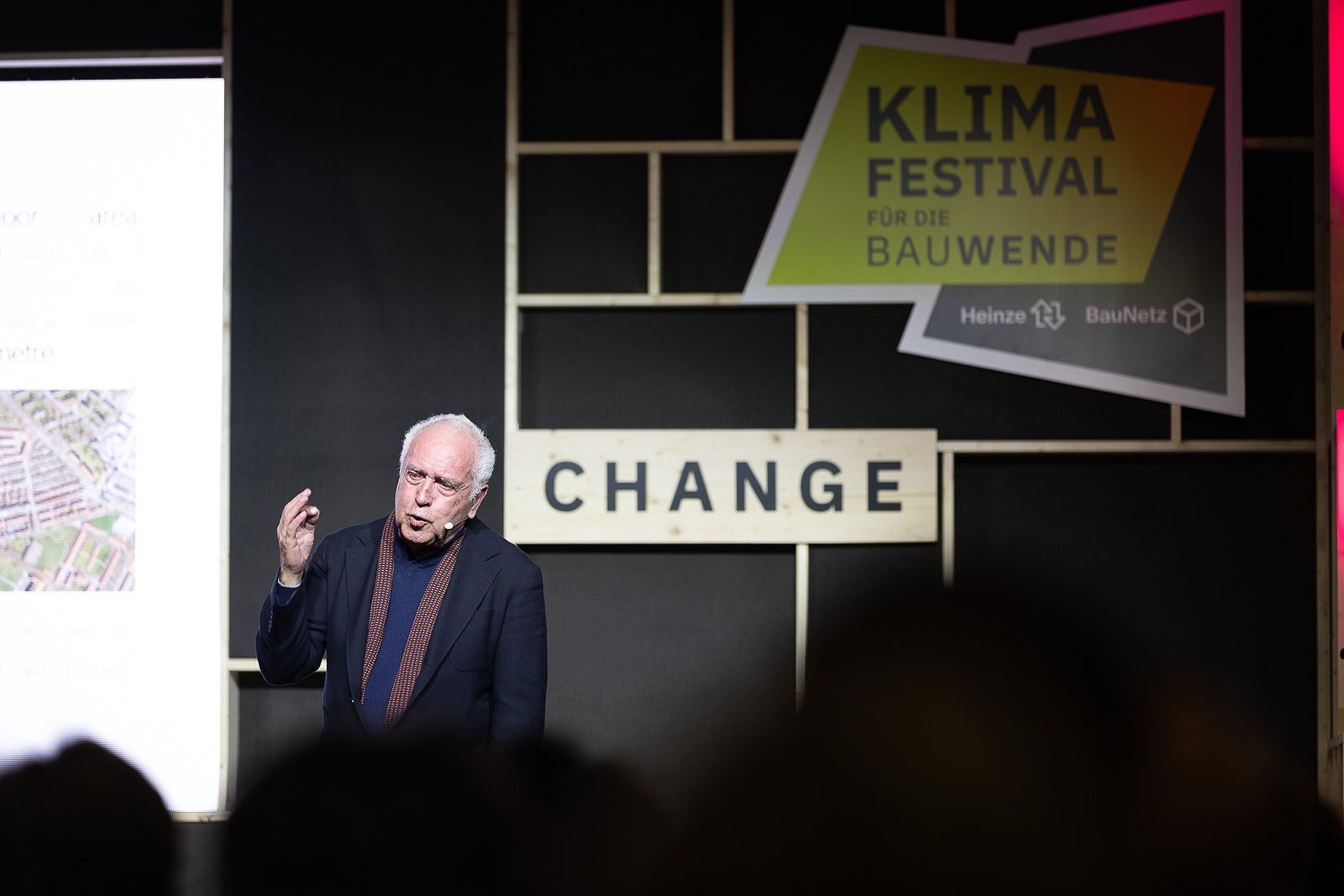
Foto: Marcus Jacobs
Prof. Dietmar Eberle hielt den Abschlussvortrag des Klimafestivals in Berlin und präsentierte zentrale Gedanken zur nachhaltigen Architektur.
Er ist Mitgründer des international renommierten Büros Baumschlager Eberle mit über 350 Mitarbeitenden an 17 Standorten. Von 1999 bis 2018 lehrte Prof. Eberle an der ETH Zürich und entwickelte dort die Idee eines Gebäudes ohne Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das erste Pilotprojekt „2226“ entstand 2013 in Lustenau und gilt bis heute als wegweisend.
In seinem Vortrag betonte er, dass Nachhaltigkeit im Bauen weit über Energieeffizienz hinausgeht. Wohnkosten sind ein zentrales gesellschaftliches Thema, geprägt von Boden-, Bau- und Finanzierungskosten. Er fordert eine stärkere politische Verantwortung und verweist auf Wien, wo durch kontinuierliche Wohnbauförderung die Kosten deutlich niedriger sind als in Städten wie Paris. Für zukunftsfähige Architektur sieht er drei Schlüsselfaktoren: soziales Wohl, städtebauliche Dichte und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Er plädiert für die Abschaffung starrer Bebauungspläne zugunsten flexibler Strukturen und verweist auf die Bedeutung von Mobilität und Konzepten wie der „10-Minuten-Nachbarschaft“.
Prof. Eberle fordert Gebäude, die sich an wechselnde Nutzungen anpassen können – ein Prinzip, das er unter dem Begriff „Open Buildings“ beschreibt. Ein Beispiel ist ein Projekt in Amsterdam, bei dem die Räume ohne feste Grundrisse geplant und später vielfältig genutzt wurden. Für ihn ist entscheidend, Menschen Freiräume zu geben und Architektur als Ermöglicher gesellschaftlicher Entwicklungen zu verstehen.
Ein weiterer Schwerpunkt seines Vortrags war die Energieeffizienz. Etwa 70 Prozent des Energiebedarfs eines Gebäudes hängen vom Verhalten der Nutzer ab, nicht von der Gebäudehülle. Das Konzept „2226“ setzt auf intelligente Steuerung statt auf komplexe Technik: Sensoren und Software regulieren Temperatur, Luftqualität und Energieflüsse, wobei Nutzer jederzeit eingreifen können. So lassen sich Energiekennwerte von nur 4 bis 6 kWh/m² erreichen – deutlich weniger als bei Passivhäusern. Diese Gebäude sind nicht nur energetisch, sondern auch kostenmäßig optimiert. Bis heute wurden rund 42 solcher Projekte in Europa realisiert, von Sanierungen historischer Bauten bis zu Neubauten für Wohn- und Verwaltungszwecke.
Prof. Eberle betont, dass die Anforderungen an Architektur klar messbar sein müssen und verweist auf seine eigene Prägung durch eine Kultur der Armut, die ihn gelehrt hat, mit vorhandenen Ressourcen effizient umzugehen. Abschließend warnt er vor den wachsenden Energiebedarfen durch digitale Technologien wie KI und Kryptowährungen und fordert intelligente Lösungen, die Einfachheit, Effizienz und technologische Steuerung verbinden.
Von Silvia Ernst









